BOAT oder Chaos? Warum KI‑Agenten ohne zentrale Orchestrierung Banken in die Irre führen

Pegasystems
Von Michael Baldauf und Florian Lauck-Wunderlich
Banken setzen bereits in zahlreichen Bereichen auf KI, etwa bei der Betrugserkennung, der Bewertung von Sicherheiten und der Personalisierung von Angeboten. Der nächste logische Schritt ist nun der Einsatz von KI-Agenten, die eigenständig arbeiten und dabei Ziele verfolgen, Lösungswege suchen und Entscheidungen treffen, sodass sie auch komplexe Aufgaben wie die Bewilligung eines Kredits übernehmen können.Der Mensch ist dabei lediglich als Kontrollinstanz tätig, die Fehlentscheidungen verhindert oder vom Agenten bei Sonderfällen wie einem ungewöhnlich hohen Kreditvolumen hinzugezogen wird.

Pegasystems
Die eigenständige Arbeit der Agenten – ohne oder nur mit wenigen menschlichen Eingriffen – erhöht nicht nur den Automatisierungsgrad der Banken und sorgt für effiziente Abläufe, sondern verbessert auch die Self-Services für Kunden. Der Kontakt zu einem Mitarbeiter oder das Warten, bis ein Mensch ein Dokument geprüft, eine Entscheidung getroffen, eine Freigabe erteilt hat, entfällt in der Regel. Daher ist das Potenzial von KI-Agenten im Kundenservice besonders groß. Idealerweise sitzt dort aber nicht ein einzelner, mächtiger KI-Agent, der alles kann und sich um alles kümmert. Leichter entwickeln, einfacher pflegen und besser beherrschen lassen sich mehrere spezialisierte Agenten, die zusammenarbeiten.
Im Grunde ist es wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis Unternehmen ihre KI-Agenten mehr oder weniger wie Mitarbeiter betrachten.“
Auf beiden Seiten gibt es Generalisten und Spezialisten, und beide benötigen Trainings und klare Regeln, stimmen sich untereinander ab und erledigen komplexe Tätigkeiten, an deren Ende ein fertiges Arbeitsergebnis steht. Kein Wunder, dass bei den Beratern von McKinsey bereits eine „Digital Workforce“ und Organigramme mit menschlichen Mitarbeitern und KI-Agenten diskutiert werden.
Spezialisierung sorgt für kompetente Beratung
Hinter den verschiedenen KI-Agenten stecken jeweils viele unterschiedliche Technologien – etwa natürliche Sprachverarbeitung (NLP) für die Kommunikation mit Menschen, große und kleine Sprachmodelle (LLMs und SLMs) für die Analyse und Generierung von Inhalten, Machine Learning für die Erkennung von Mustern und Anomalien, optische Zeichenerkennung (OCR) für die Verarbeitung eingescannter Dokumente und natürlich auch ganz klassische regelbasierte Systeme. All das erlaubt es, die Agenten genau auf die jeweilige Aufgabe zuzuschneiden, sodass sie diese optimal beherrschen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten Agenten über APIs einen Zugriff auf Anwendungen und Funktionen, etwa einen Browser oder ein Statistik-Tool, sowie interne oder externe Daten und Wissenspools wie einen Produktkatalog. Diese können sie selbstständig wie ein Mensch bedienen beziehungsweise nutzen. Ein KI-basierter Produkt-Agent kennt sich dadurch perfekt mit den Angeboten der Bank aus – weitergehendes Wissen hat er und braucht er nicht.
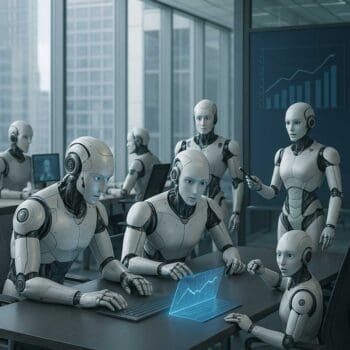
ChatGPT
Vorstellbar ist auch, dass es nicht nur einen einzigen Produkt-Agenten gibt, sondern mehrere, zum Beispiel einen für Konten und Kreditkarten, einen für den Wertpapierhandel, einen für Baufinanzierungen und einen für andere Kredite. Auf diese Weise können die Agenten fokussierter konfiguriert und ausgerichtet werden und kompetenter zu den Produkten der Bank beraten. Und sie lassen sich später, wenn es Änderungen bei einem Produkt gibt, einfacher anpassen.
Welcher Produkt-Agent eingesetzt wird, entscheidet ein Conversational-Agent. Er ist für die Kommunikation mit dem Kunden zuständig und versucht, wie bisher der Berater, zunächst das Anliegen des Kunden zu ermitteln. Das funktioniert in der Praxis schon sehr genau, was wichtig ist, damit der Agent im Anschluss die richtigen Rückfragen stellen kann. Diese unterscheiden sich schließlich selbst bei Kreditwünschen – je nachdem, ob es um einen Hauskauf oder die Finanzierung einer Urlaubsreise geht.
Strukturierte Abläufe statt Prozesswildwuchs
Bei einer Kreditanfrage würde der Conversational-Agent neben dem passenden Produkt-Agenten noch eine ganze Reihe weiterer Agenten hinzuziehen, etwa für die Bewertung von Risiken und Sicherheiten.
Hinzu kommen verschiedene Compliance-Agenten, die Einhaltung aller Regeln der Bank sicherstellen und KYC-Checks durchführen, während Dokumenten-Agenten die hochgeladenen Dokumente auf Echtheit prüfen, Daten extrahieren und verifizieren.“
Andere Agenten würden Informationen aus den Kernsystemen der Bank abrufen oder dort aktualisieren, falls der Kunde neue Daten liefert. Ergänzend dazu könnten Research-Agenten beispielsweise im Internet zu den Immobilien recherchieren, die mit dem Kredit erworben werden sollen oder als Sicherheit hinterlegt wurden.
Die Orchestrierung der Agenten kann auf unterschiedliche Weise erfolgen: durch vordefinierte Prozessflüsse, die in Stages und Schritte untergliedert sind, oder ad hoc durch einen Orchestrierungsagenten, der kontext- und fallbezogene Entscheidungen trifft. Ebenso sind aber auch hybride Ansätze möglich. Der Austausch und die Aushandlung von Zwischenergebnissen, Bewertungen oder Entscheidungen zwischen einzelnen Agenten können entweder über gruppenbasierte Kommunikationskanäle oder über die Nutzung gemeinsamer Variablen- und Datenfelder realisiert werden.
Die Entscheidung, in welcher Reihenfolge die anderen Agenten beauftragt werden, kann grundsätzlich ein Agent treffen. Ein strukturierter, weitgehend vorgegebener Ablauf ist jedoch in einigen Fällen sinnvoller, damit der Agent die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellt. Zudem gibt es in der Finanzbranche umfangreiche Prüf- und Dokumentationspflichten, die exakt eingehalten werden müssen – da ist eine möglichst geringe Varianz bei den Abläufen durchaus erstrebenswert. Ein zentrales Prozessmodell muss daher für die korrekte Abfolge aller Schritte sorgen, insbesondere derjenigen, die Compliance-Vorgaben und Risikomanagement betreffen. Ganz so, wie menschliche Mitarbeiter eine Fragestellung nicht unkoordiniert bearbeiten, sondern sich an Abläufe, Regeln und Vereinbarungen halten.
 Florian Lauck-Wunderlich ist Technical Solutions Director AI and Advanced Analytics Consulting EMEA bei Pegasystems (Website)
Florian Lauck-Wunderlich ist Technical Solutions Director AI and Advanced Analytics Consulting EMEA bei Pegasystems (Website)Ein KI-System muss bei identischer Datenlage konsistente Entscheidungen treffen.“
Neben einem zentralen Prozessmodell braucht es daher auch ein übergeordnetes Regelwerk, das sicherstellt, dass sämtliche Aktivitäten in standardisierter und nachprüfbarer Weise ausgeführt werden. Bei der Implementierung solcher Lösungen müssen verschiedene Ebenen betrachtet werden: Business-Regeln, die fachliche Vorgaben und Entscheidungslogiken abbilden, Risiko-Kernel, die kritische Schwellenwerte und Sicherheitsmechanismen definieren, sowie LLM-basierte Entscheidungsmechanismen, die kontextuelle Flexibilität und adaptives Handeln ermöglichen.
 Michael Baldauf ist Industry Principal Financial Services Senior Director bei Pegasystems (Website)
Michael Baldauf ist Industry Principal Financial Services Senior Director bei Pegasystems (Website)Eine zentrale Aufsicht für alle Agenten
Prädestiniert für solche Aufgaben ist eine BOAT-Plattform (Business Orchestration and Automation Technologies), die alle Abläufe und Agenten überwacht und steuert. Sie bietet zudem den Vorteil, dass Geschäfts- und andere Regeln global definiert werden können und nicht in die einzelnen Agenten eingebettet werden müssen, was inkonsistente Regeln verhindert und den Aufwand für die Pflege der Regelwerke reduziert. Sie entscheidet anhand von Regeln auch darüber, wann es an der Zeit ist, einen Menschen in den jeweiligen Prozess zu involvieren. Dieser fungiert dann als sogenannter „Human in the Loop“ und kontrolliert oder trifft Entscheidungen mit großer Tragweite oder mit hohem Fehlerpotenzial.
Ein Agent oder eine Engine für Hyperpersonalisierung sorgt innerhalb der BOAT-Plattform dafür, dass die Produkt-Agenten nicht nur zu den jeweiligen Produkten beraten, sondern auch individuelle Angebote erstellen können.
Dafür greift die Engine auf Informationen anderer Agenten zurück und kalkuliert unter anderem auf Basis der Kundenhistorie, Sicherheiten und Risken die individuellen Kreditkonditionen, die die Interessen der Bank und des Kunden ausbalancieren.“
Dabei nutzt sie Regelwerke, Logiken und Wahrscheinlichkeiten und verlässt sich nicht allein auf KI. Denn dann bestünde die Gefahr, dass sie für die Bank unvorteilhafte Konditionen anbietet, weil sie vielleicht aus historischen Daten gelernt hat, dass die Akzeptanzquote von Angeboten mit niedrigen Kreditzinsen höher ist.
Idealerweise ist die BOAT-Plattform mit einem Case-Management verknüpft, sodass sie Kunden und Kundenanfragen zuordnen kann und bei allen Cases den Überblick behält. Wechselt ein Kunde den Kanal oder hat zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Frage, ist der Conversational-Agent sofort auf dem aktuellen Stand, ohne dass der Kunde noch mal alles erklärt. Auf diese Weise ermöglichen KI-Agenten, die innerhalb einer zentralen Plattform sicher und transparent zusammenarbeiten, eine völlig neue Art der Automatisierung von Bankprozessen und heben insbesondere die Self-Services für Kunden auf ein völlig neues Level. Michael Baldauf, Florian Lauck-Wunderlich, Pegasystems
Sie finden diesen Artikel im Internet auf der Website:
https://itfm.link/233684




Schreiben Sie einen Kommentar